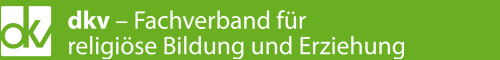Ob Albert Camus, Janet Frame, Elias Canetti oder auch Gabriele Miller: ihre Lehrer hinterließen einen so prägenden Eindruck, dass die Genannten in ihnen, in ihren gelehrten Inhalten oder auch ihren Persönlichkeiten wesentliche Grundlagen für ihr eigenes Wirken und ihre Prägung sahen. So schreibt etwa Elias Canetti in „Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend“ aus dem Jahr 1977: „Da ich sie jetzt an mir vorüberziehen lasse, staune ich über die Verschiedenartigkeit, die Eigenart, den Reichtum meiner Züricher Lehrer. Von vielen habe ich gelernt, wie es ihrer Absicht entsprach … aber auch die, von denen ich nur wenig gelernt habe, stehen als Menschen oder Figuren so deutlich vor mir, dass ich ihnen eben dafür etwas schulde.“ „Das alles“, so Cannetti weiter, „wie es zusammenwirkt, ist noch eine ganz andere als die deklarierte Schule, eine Schule nämlich auch der Vielfalt von Menschen und, wenn man sie halbwegs ernst nimmt, auch die erste bewusste Schule der Menschenkenntnis.“
Janet Frame hingegen betont die große Rolle, die der Lehrer Gussy in ihrer eigenen Persönlichkeits- und Lernentwicklung spielte, wenn sie in ihremautobiografischem Roman „Ein Engel an meiner Tafel“ über ihn, dessen Lieblingsschülerin sie war, schreibt: „Unter GussysObhut blühte und gedieh ich, sowohl als Lernende als auch als Sportlerin, denn Gussy war der Überzeugung, dass jedes Kind ein besonderes Talent habe und er als Lehrer jedem eine Chance geben müsse, dieses Talent zu entdecken.“
Die Lehrer scheinen in den literarischenBeispielen im Lern- und Entwicklungsprozess der „Kinder“ wichtige Personen gewesen zu sein. Doch welche Rolle kommt ihnen in der neuesten Forschung und besonders mit Blick auf die religiösen Lernprozesse in Schule und Gemeinde zu? Sind sie tatsächlich in ihrer Persönlichkeit wesentlicher Faktor im Lerngeschehen oder sind sie eher Moderator und Lernbegleiter, die sich im Prozess des Lehrens und Lernens zurücknehmen? Diese Fragestellung war Gegenstand der diesjährigen Religionspädagogischen Jahrestagung vom 25.-29. September im Liborianum in Paderborn.
Der Lehrer – unverzichtbar?
Christoph Türcke, emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, stellte als Auftaktredner sein Referat unter die provokante Überschrift „Die Unverzichtbarkeit des Lehrers“. Gemäß dem Ziel, grundsätzliche Überlegungen zum Lehrer- Schüler-Verhältnis aufzuzeigen, präsentierte er eine breite Palette erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen bis hin zur Rolle von Methoden und Frontalunterricht. Von archaisch-deiktischen Lernstrukturen der Bronzezeit ausgehend, nahm er dabei besonders das frühkindliche Lernen in den Blick. In der triadischen Phase, also im Alter von neun Monaten, ließen sich, so Türcke, Säuglinge von Erwachsenen erstmals auf Gegenstände hinweisen. In diesem Sinn sei ein Lehrender der- oder diejenige, die oder der ein Kind bzw. dessen Aufmerksamkeit zu einem gemeinsamen Dritten führt und es auf diese Weise die Welt entdecken lässt. Dabei machten Eltern Kindern ungleich mehr vor als das, was sie ihnen bewusst hervorheben.
„Komplexe Eigenschaften übertragen sich“. Auch wenn Eltern die ersten Lehrer seien: „Gerade aufgrund ihrer räumlichen und emotionalen Nähe müssen sie die Stafette irgendwann an Kindergarten oder Schule übergeben“, so Türcke. Die Lehrerinnen und Lehrer würden dann gerade in der Grundschulzeit auch zu Identifikationsfiguren und damit zu bedeutenden Persönlichkeiten für die Kinder.
Zwar sei eine Lehrperson erst dann gut, wenn sie sich selbst überflüssig mache, aber: „Selbstständigkeit benötigt
Boden unter den Füßen“, so Türcke. Erreicht werde dies durch hinweisende Tätigkeit, stabile Strukturen, Wiederholung und Einübung. Daher sei klar: „Ein vollkommen deregulierter Unterricht überlässt die Kinder sich selbst.“ Lehrpersonen seien wichtig, betonte der Referent und unterstützte mit einem Plädoyer für den Frontalunterricht die zentrale Bedeutung der Lehrkraft für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler: Nur in dem Maße, wie sie in der Lage seien, „stabile Identifikationsfiguren zu sein, sind sie in der Lage, nachhaltiges Interesse an einer Sachebei Schülerinnen und Schülern zu entwickeln.“
Reflektion als Unterrichtsprinzip
Gerade auf dem Hintergrund der Hattie-Studie, die eine Auswertung von 52637 Einzelstudien und somit das Ergebnis von 15 Jahren empirischer Unterrichtsforschung ist, scheint sich diese zentrale Rolle der Lehrperson zu bestätigen. Denn die Studie rückt den Lehrer deutlich in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Doch worum geht es Hattie wirklich? Sind reißerische Überschriften, wie sie etwa DIE ZEIT in ihrem Artikel mit der Überschrift „Ich bin superwichtig“ vom 14. Januar 2014 aufmacht, gar eine Fehlinterpretation dieser Studie? „Was ich nicht sage, ist, dass es auf die Lehrpersonen ankommt“, so ein Zitat Hatties. „Lernen“, so Hattie „muss von den Lehrpersonen aus der Perspektive der Lernenden betrachtet werden, damit sie besser verstehen, wie das Lernen aus
der Sicht der Lernenden aussieht.“ Personen, die sich selbst für wichtig halten, scheinen fehl am Platz. Kognitive Empathie und Aktivierung der Lernenden lautet vielmehr das didaktische Gebot. Mit den Zielen, Aufgaben und Erkenntnissen der Hattie-Studie setzte sich Andreas Helmke, emeritierter Professor für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau, Hattie-Experte und Berater zahlreicher Bildungsträger und Ministerien auseinander. „Die Hattie-Studie als Lehrer-Bibel“ hatte er seinen Vortrag überschrieben, indem er zu Beginn noch einmal nachdrücklich auf die Bedeutung empirischer Befunde für die Unterrichtsentwicklung hinwies: Wirksamkeit von Lehr- und Lernsituationen zu arbeiten, statt mit unbelegten Behauptungen, Ideologien und Heilslehren im Nebel zu stochern, sei das grundsätzliche Anliegen Hatties gewesen. Aufbauend auf diesen Erkenntissen machte Helmke fünf wirkungsmächtige, fach- und methodenübergreifende Aspekte lernwirksamen Unterrichts aus. Neben der kognitiven Aktivierung seien ein lernförderliches Klima, die Klarheit und Strukturiertheit des Unterrichts, ein gutes Klassenmanagement sowie eine erfolgreiche Sicherung der Lerninhalte als Rahmenbedingung erfolgreichen Lernens erforderlich. Die größte Effektivität im Hinblick auf das Lernen aber herrsche dann, so Helmke, wenn Lehrpersonen in Bezug auf das Lehren selbst zu Lernenden und auf diese Weise lernende Lehrpersonen würden. Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler sollten zu Evaluatoren des Unterrichts werden. „Die kollegiale Reflexion über den Unterricht, ist aus Sicht Hatties die zentrale Konsequenz seiner Studie“, so Helmke. Einen besonders positiven Einfluss auf den Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und Schüler hätten aber auch eine angstfreie, entspannte Unterrichtsatmosphäre sowie ein konstruktiver Umgang mit Fehlern.
Keine Angst vor Professionalität
Wenn Lehrpersonen und deren Fähigkeit, Lehr- und Lernprozesse ausder Perspektive von Schülerinnen und Schüler zu gestalten und zu reflektieren,von zentraler Bedeutung für die Lernwirksamkeitvon Unterricht sind, dann muss diese Erkenntnis auch Auswirkungenauf die Professionalitätsdebattevon Lehrerinnen und Lehrern und damit auch für Religionslehrkräfte haben. Religionslehrer/in werden ist nicht schwer,eine/r sein dagegen sehr, so könnte ein Eingangsstatement des Vortrags von RitaBurrichter, Professorin für Praktische Theologie an der Universität Paderborn, lauten, scheinen doch derzeit viele Religionslehrerinnen und -lehrer oftmals abwehrend auf den Begriff der Professionalität bzw. der Professionalisierung zu reagieren. In ihrem Referat thematisierte Burrichter Anforderungen an und das Selbstverständnis von Religionslehrkräften.
„Die Abwehrhaltung“, so Burrichter, „sei vielleicht auch darin begründet, dass der Begriff Professionalität oftmals im bildungstheoretischen Sinne als reine Wenn-Dann-Konstruktion, also in seiner rein technischen Seite verstanden wird.“ Dabei, so stellte Burrichter zu Beginn ihrer Einlassungen heraus, „macht der Professionalitätsbegriff nicht nur die technische Seite im Sinne von Fach- und Methodenkompetenz stark, sondern gerade die personale Relation.“ Immer nämlich werde „auf einen konkreten Fall hin transformiert [...] Diese Vermittlung zwischen Regelanwendung und Fallbezug rechnet sozusagen systematisch mit der Unterschiedlichkeit von Bedingungen, auch mit Unstetigkeit, sogar mit Unwägbarkeiten und mit Brüchen“, so Burrichter. Kein starres technisches Regelwerk gelte es also als Lehrkraft, speziell als Religionslehrkraft, abzuarbeiten, sondern die Schülerinnen und Schüler in ihrer aktuellen Situation ernst zu nehmen. Diese personale Relation, die wichtig im Unterrichtsgeschehen ist, sei aber nicht mit derPersönlichkeit der Lehrkraft zu verwechseln, sondern trete im Arbeitsbündnis von Schule bzw. enger gefasst von Unterricht auf. Auf die Persönlichkeit komme es weniger an. „Worauf es tatsächlich ankommt, ist, dass Lehrpersonen über eine Geisteshaltung verfügen, die sie veranlasst, ihre Wirkung auf das Lernen zu evaluieren“, zitierte Burrichter aus Hatties neuestem Werk „Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen“. Um die besondere Schwierigkeit der Religionslehrinnen und -lehrer, die sichoftmals einem hohen Anspruch gerade auch der Kirche gegenüber sehen, zu verdeutlichen, nahm Burrichter die Rolle der Lehrperson in den bischöflichen Dokumenten und die dortigen Professionszuschreibungen in den Blick: „Die uns allen vermutlich besonders vertraute Metapher des Religionslehrers als Zeugen kommt im Synodenbeschluss ganz deutungsoffen daher,“ so Burrichter. Die Metapher bezieht sich im Synodenbeschluss „Der Religionsunterricht in der Schule“ (1974) noch auf „die Sache selbst“, das Evangelium und die Frage nach Gott, nicht aber auf die Institution Kirche. Zudem trete sie dort in Form eines Tätigkeitswortes auf. Erst in der programmatischen Rezeption des Synodenbeschlusses wird später daraus in durchaus gewollter Prägnanz „Der Religionslehrer als Zeuge“. Damit verändere sich aber, so Burrichter, auch die Perspektive der biblischen Grundmetapher: weg von der Fähigkeit kommunikativen Handelns in unterrichtlichen Prozessen hin zu Persönlichkeit und individuellen Haltungen der Lehrkraft. Im Letzten sei dies ein Schritt hin zum Zeugnis des Glaubens der Kirche in der Schule. So heißt es im Bischofsdokument „Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen“ (2005), dass die Religionslehrer/innen gesandt seien, „Zeugen des Glaubens in der Schule“ und „Brückenbauer zwischen Schule und Kirche“ zu sein. Doch was bedeutet dies?

Stehen im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und kirchlicher Erwartung: junge Religionslehrer/innen
Als „Bildungs- und Traditionsagenten“ von Kirche entwickelten Lehrerinnen und Lehrer ihre Lehrinhalte immer in didaktischem Bezug auf ihre Schülerinnen und Schüler hin. „In dieser strikt religionsdidaktisch und schulpädagogisch begründeten und zielenden Perspektive, die Ausdruck religionspädagogischer Professionalität ist, ist dann auch – im Selbstverständnis der Religionslehrerinnen und Religionslehrer – ihr kirchlicher Verkündigungsauftrag realisiert“, so Burrichter. Religionslehrerinnen und -lehrer, seien selbst Teil der gesellschaftlichen Prozesse (religiöser) Pluralisierung und Individualisierung.Umfassende Zugänge zur Tradition und Zugänge zu stetigen Formen von Religiosität, gar zu stetigen Formen von kirchlicher Partizipation seien die Ausnahme, zumindest unter den Studierenden der Religionspädagogik. Lehrerinnen und Lehrer wichen daher vielfach einer Positionierung aus, zögen sich hinter Methoden zurück, und tauchten auf eine religionskundliche Ebene ab, wie die Untersuchungen der Religionspädagogischen Forschungsgruppe Essen ergeben hätten. „Daran“, so Burrichter, „ist im Horizont religionspädagogischer Professionalisierung zu arbeiten.“
Kompetenz in der Katechese
Während das Feld der Professionalisierung im religionsunterrichtlichen Bereich bereits seit längerem Teil wissenschaftlicher Forschung ist, ist die Katechese diesbezüglich immer noch ein Stiefkind universitärer Tätigkeit. Darauf wies Prof. Monika Scheidler, Professorin für Religionspädagogik an der Technischen Universität Dresden, in ihrem Vortrag „Professionalität in der Katechese“ hin. Erste Schritte in Richtung Professionalisierung seien zwar sichtbar – Scheidler verwies auf die Standards von Katechese im bischöflichen „Dokument“ Katechese in veränderter Zeit (2004) –, erst allmä![]()
![]()
![]() hlich aber rücke die Professionalisierung in den Fokus der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Dies mag damit zusammenhängen, dass Professionalität im katechetischen Tun nicht ausnahmslos oder sogar in den wenigsten Fällen an einen bestimmten Beruf, den des Priesters, des Diakons, der Pastoral- oder Gemeindereferent/in, gebunden ist. Ehrenamtliche wie hauptamtliche Katechetinnen und Katecheten nähmen je für sich in Anspruch, Katechese „professionell“, d. h. authentisch, zu betreiben, geht es doch um ihren gelebten Glauben und dessen Bezug zum Leben. Professionalität erfordere aber auch hier Reflexionsfähigkeit im Sinne Hatties, denn, so stellte Scheidler heraus: „Der Glaube wird selbst immer wieder im Gespräch reflektiert und angefragt. Katechetische Professionalität geht nicht ohne Einbettung in ein persönliches Glaubensverständnis.“ Ein Einlassen auf diese Infragestellung, so Scheidler, sei eine Form von Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, die katechetischen Lehrpersonen eigen sein müsse, und damit Teil ihres professionellen Handelns. Nimmt man die Katechese lerntheoretisch in den Blick, so gebe es jedoch im Vergleich zum Lernraum Schule grundsätzlich mehr Freiräume für aktives, konstruierendes und selbstständiges Lernen der Einzelnen, was für die Befähigung zum Christsein und die Weitergabe des Glau- bens unabdingbar sei. Sicher sei auch die theologische Expertise in katechetischen Situationen gefragt, aber nicht im Sinne eines reinen Katechismuswissens, sondern eines Glaubens, der sich im Alltag bewährt habe. Gerade ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten könnten Zeugnis geben von dem, was sie trägt, ohne „theologische Alleswisser“ zu sein. Ehrenamtliches professionelles Handeln könne zudem in Zuwendung, Begleitung und Anleitung katechetischer Wege bestehen, indem Katechetinnen und Katecheten „die verschiedenen Lebensweisen der Teilnehmer an katechetischen Prozessen empathisch wahrnehmen, die Perspektive wechseln, sich dabei in Frage stellen und die Teilnehmenden bei der Suche nach Gottes Spuren in ihrem Leben unterstützen“, betonte Scheidler.
hlich aber rücke die Professionalisierung in den Fokus der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Dies mag damit zusammenhängen, dass Professionalität im katechetischen Tun nicht ausnahmslos oder sogar in den wenigsten Fällen an einen bestimmten Beruf, den des Priesters, des Diakons, der Pastoral- oder Gemeindereferent/in, gebunden ist. Ehrenamtliche wie hauptamtliche Katechetinnen und Katecheten nähmen je für sich in Anspruch, Katechese „professionell“, d. h. authentisch, zu betreiben, geht es doch um ihren gelebten Glauben und dessen Bezug zum Leben. Professionalität erfordere aber auch hier Reflexionsfähigkeit im Sinne Hatties, denn, so stellte Scheidler heraus: „Der Glaube wird selbst immer wieder im Gespräch reflektiert und angefragt. Katechetische Professionalität geht nicht ohne Einbettung in ein persönliches Glaubensverständnis.“ Ein Einlassen auf diese Infragestellung, so Scheidler, sei eine Form von Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, die katechetischen Lehrpersonen eigen sein müsse, und damit Teil ihres professionellen Handelns. Nimmt man die Katechese lerntheoretisch in den Blick, so gebe es jedoch im Vergleich zum Lernraum Schule grundsätzlich mehr Freiräume für aktives, konstruierendes und selbstständiges Lernen der Einzelnen, was für die Befähigung zum Christsein und die Weitergabe des Glau- bens unabdingbar sei. Sicher sei auch die theologische Expertise in katechetischen Situationen gefragt, aber nicht im Sinne eines reinen Katechismuswissens, sondern eines Glaubens, der sich im Alltag bewährt habe. Gerade ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten könnten Zeugnis geben von dem, was sie trägt, ohne „theologische Alleswisser“ zu sein. Ehrenamtliches professionelles Handeln könne zudem in Zuwendung, Begleitung und Anleitung katechetischer Wege bestehen, indem Katechetinnen und Katecheten „die verschiedenen Lebensweisen der Teilnehmer an katechetischen Prozessen empathisch wahrnehmen, die Perspektive wechseln, sich dabei in Frage stellen und die Teilnehmenden bei der Suche nach Gottes Spuren in ihrem Leben unterstützen“, betonte Scheidler.
Der Vortrag zum Thema „Der lernende Gott braucht lernende Menschen“ bildete den Abschluss der Tagung. Dr. Oliver Reis, Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Katholische Theologie der Universität Dortmund, plädierte dafür, im Religionsunterricht nicht so sehr die Differenz von Glauben und Leben zu betonen, sondern das Leben mit den Lehrsätzen des Glaubens zu verweben: „Die Ebene der Lehre, der Religion und die normale Realität der Schüler müssen miteinander in Schwingung kommen.“ Um sein Lernmodell zu verdeutlichen, gebrauchte Reis das Bild eines Hauses mit drei Ebenen: Im Keller befinde sich die Normrealität der Schüler. Der Lehrer, der in diesem Fall die Lehrsätze verkörpert, sitze im Dachgeschoss. Erst wenn beide Bereiche im Mittelteil, dem Erdgeschoss, miteinander verwoben würden, hätte der Lernprozess Aussicht auf Erfolg. Dabei gelte es, keine vorgefertigten Antworten der Schüler zu erwarten, sondern das Leben im Licht des Lebens zu deuten. Es gehe um ein Verweben von Lehre und Normalrealität im Sinne einer Reflexion. So könne menschliches Lernen analog zum göttlichen Lernen geschehen: „Der Vater,“ so Reis, „steht für die verlässliche Ordnung, die die Welt für uns bestimmbar macht. Der Sohn ermöglicht die Entdeckungsreise des menschlichen Lebens. Der Geist hinterfragt jeweils aus der Sicht des Einen den Anderen und sorgt so für eine ständige Reflexionsbewegung.“
Der Lehrende – Versuch eines Fazits
Beim Lehren lernt man. Dieser Satz Senecas aus dem ersten Jahrhundert nach Christus scheint nach 2000 Jahren aktueller zu sein denn je. Für ein professionelles Interagieren in Religionsunterricht wie Katechese, so zeigten die Vorträge, Diskussionen und Workshops, müssen Lehrende neben theologischer Expertise und religionspädagogisch-didaktischer Kompetenz vor allem die Bereitschaft auf- bringen, sich und die initiierten Lehr- und Lernprozesse selbstkritisch zu reflektieren und weiterentwickeln zu wollen. „Ich bin superwichtig“ jedenfalls kann nicht das oberste Kriterium für die Haltung von Lehrpersonen sein, vielmehr könnte das Motto – katechetisch wie schulischlauten: Lass mich von dir lernen, damit ich den Lernprozess noch effektiver und zu deinem Vorteil gestalten kann. In diesem Sinne sind Lehrende wichtig und unverzichtbar: als Vorbild und Modell für das lebenslange Lernen im Glauben und das Reifen als Mensch.